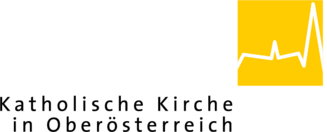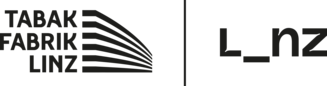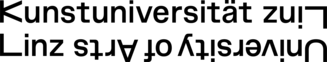1672-2022. KU_biläum.
Vom Kolleg zur Universität. 350 Jahre KU Linz.
Der beschleunigte Wandel unserer Lebenswelten und die Dynamik der politischen, sozioökonomischen und technischen Entwicklungen lassen Fragen nach Sinn und Werten, nach Individuum und Weltgemeinschaft, nach religiösen Traditionen und ihrer Rede von Gott neu und anders bewusst werden. Solidarität, Nachhaltigkeit, Chancengerechtigkeit und Verantwortung für Mensch und Umwelt sind (über)lebenswichtig.
Die Fachbereiche Theologie, Philosophie und Kunstwissenschaft der Katholischen Privat-Universität Linz erforschen Möglichkeitsbedingungen und entwickeln Handlungsoptionen. In einer Zeit vielfältiger und wachsender Herausforderungen sind insbesondere auch die Geisteswissenschaften gefordert, ihre Expertise und ihr Wissen in die Gesellschaft einzubringen.
Das 350-Jahr-Jubiläum nahmen wir zum Anlass, uns im Studienjahr 2022/23 im Rahmen einer elfteiligen Veranstaltungsreihe an unterschiedlichen Orten in Linz im Dialog mit Partner:innen aus Wissenschaft, Kultur, Kirche, Wirtschaft, Politik und Medien als traditionsreiche Institution mit Perspektiven für Gegenwart und Zukunft zu präsentieren.
Anfang Oktober 2022 erschien zudem eine Sonderbeilage in den Oberösterreichischen Nachrichten, in der die KU Linz einem breiten Publikum vorgestellt wurde. Eine blätterbare Ansicht der KU_biläumsNachrichten findet sich am Ende dieser Seite.
Das waren die Veranstaltungen des KU_biläums
Ökumenische Sommerakademie über Gesellschaft ohne Vertrauen.

Im Fundament unserer Gesellschaft ist ein Riss entstanden. Vertrauen als eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Funktionieren dieser Gesellschaft und ihrer Einrichtungen scheint verloren gegangen zu sein. Ohne Vertrauen in die politischen Institutionen schwindet die Bereitschaft zur Beachtung der Spielregeln der Demokratie und zur Einhaltung ihrer Normen. Ohne Vertrauen verlieren Kirchen und Religionsgemeinschaften ihre moralische Autorität und damit ihren Stellenwert in der Gesellschaft. Ohne Vertrauen funktionieren persönliche Beziehungen nicht mehr.
Dramatische Entwicklungen der letzten Jahre haben dieses Vertrauen auf vielen Ebenen gestört. Machtmissbrauch, moralisches Fehlverhalten von Verantwortungsträgern, Hetze und Hass vorwiegend in den sogenannten sozialen Medien verursachen ebenso wie eine Überforderung im Verstehen und Verarbeiten wissenschaftlicher Erkenntnisse breites Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und seriöser, ausgewogener Berichterstattung. Die Bedrohung der Gesundheit durch die Pandemie und gleichzeitig die Verbreitung von Verschwörungstheorien und schlichten Erklärungsversuchen komplexer Fakten führen zu Ängsten und Brüchen auch in Familien und zwischen Freund:innen. Kirchen haben ihre Glaubwürdigkeit durch Missbrauch von Wehrlosen und starres Festhalten am Überkommenen verloren.
Die 23. Ökumenische Sommerakademie im Stift Kremsmünster greift unter dem Titel "Gesellschaft ohne Vertrauen – Risse im Fundament des Zusammenlebens" dieses Thema auf. Bei der traditionellen Veranstaltung, die heuer von 13. bis 15. Juli wieder in gewohnter Form stattfindet, werden im Dialog zwischen Theolog:innen, Kirchenvertreter:innen und Wissenschafter:innen die Ursachen analysiert und überlegt, wie die Risse im Fundament des Zusammenlebens entstanden sind, welche Folgen sie haben und wie sie behoben werden können.
Am ersten Tag referierten nach den Eröffnungsworten von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer und den Impulsvorträgen von Rektor Univ.-Prof. Dr. Christoph Niemand, Superintendentialkuratorin Mag.a Renate Bauinger und Bischof Andrej Ćilerdžić Dr. Philipp David, Professor für Systematische Theologie / Ethik an der Justus-Liebig-Universität Gießen, und Jan Wetzel, M. A., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Etwa 250 Interessierte betrachteten am ersten Tag mit den renommierten Referent:innen die Bedeutung von Vertrauen für Individuen und die Gesellschaften, Ursachen für fehlendes Vertrauen, Möglichkeiten, Vertrauen zu stärken, und den Zusammenhang von Vertrauen und Autorität. Unter den Gästen waren Persönlichkeiten aus Kirche, Politik und Gesellschaft sowie Vertreter:innen der Veranstalter:innen, etwa Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Landeshauptmann a. D. Dr. Josef Pühringer, der Bürgermeister von Kremsmünster Gerhard Obernberger, Bischof Dr. Manfred Scheuer, Generalvikar DDr. Severin Lederhilger OPraem, Pastoralamtsdirektorin Mag.a Gabriele Eder-Cakl, Superintendentialkuratorin Mag.a Renate Bauinger, die Oberkirchenrätin der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich Mag.a Ingrid Bachler, der Bischof der Altkatholischen Kirche Dr. Heinz Lederleitner, der Bischof der Serbisch-orthodoxen Kirche Österreich-Schweiz-Italien und Malta Andrej Ćilerdžić, Gastgeber und Hausherr Abt Mag. Ambros Ebhart, der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Diakoniewerks Gallneukirchen Mag. Josef Scharinger, MAS, der Rektor der Katholischen Privat-Universität Linz Univ.-Prof. Dr. Christoph Niemand, der Rektor der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten Dr. Peter Pantuček-Eisenbacher, der Landesdirektor des ORF Oberösterreich Klaus Obereder, der stv. Chefredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten Mag. Wolfgang Braun und die Präsidentin des OÖ. Presseclubs Dr.in Christine Haiden. Für die KirchenZeitung Diözese Linz war Monika Slouk, Leiterin der Kooperationsredaktionen der Kirchenzeitungen, gekommen, die den erkrankten Chefredakteur Dr. Heinz Niederleitner vertrat.
Moderiert wird die Veranstaltung von Dr. Helmut Obermayr, Mitbegründer der Ökumenischen Sommerakademie und ehemaliger langjähriger Landesdirektor des ORF-Landesstudios OÖ. Er wies in seinen einführenden Worten darauf hin, dass das Thema der Veranstaltung bereits im Herbst vergangenen Jahres festgelegt worden sei: "Damals war es vor allem die Pandemie und die Auseinandersetzung um die damit verbundenen gesellschaftlichen, juristischen, grundrechtlichen Schritte. Inzwischen sind die Risse wahrscheinlich noch viel tiefer geworden und ist das Vertrauen in vielen Bereichen vielleicht noch viel mehr in Frage gestellt worden, seit der Krieg in der Ukraine begonnen hat, dessen Auswirkungen auf das alltägliche Leben jetzt für uns alle so deutlich werden – vor allem für jene, die ohnehin nicht wissen, wie sie den Alltag bewältigen können."
Stelzer: „Grundlage eines vertrauensvollen Zusammenlebens ist der Wille zum Miteinander“

Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer meinte in seinen Eröffnungsworten, er orte eine gewisse pessimistische Grundstimmung in der Bevölkerung, die zeige, dass in der Gesellschaft manches schwieriger geworden sei. Das Wort „schwierig“ sei allerdings zu relativieren, wenn man bedenke, „dass Menschen ein paar hundert Kilometer östlich von uns leben, deren Städte und Häuser zerbombt und deren Familienmitglieder ermordet werden. Oder auch, wenn wir an unsere Vorgänger-Generationen denken, die in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts mit Kriegen, Wiederaufbau, Vernichtung und Wiederaufbau zurande kommen mussten.“
Vieles sei tatsächlich anders geworden und werde wohl auch grundlegend anders bleiben, so Stelzer: für eine Generation und Gesellschaft, die lange Zeit wie selbstverständlich davon ausgegangen sei, in gesicherten Verhältnissen zu leben. In den letzten Jahren und Monaten seien Sicherheiten abhandengekommen, Widersprüchlichkeiten, Gegensätze und Aggressionen sichtbarer geworden. Der Landeshauptmann: „Die Frage einer Gesellschaft ohne Vertrauen, die den Kern dieser Ökumenischen Sommerakademie bildet, ist daher zwangsläufig aktuell. Das Vertrauen in die Institutionen, vor allem in die politischen, aber auch das Vertrauen in unser ‚gewohntes, gutes Leben‘ und letztlich das Vertrauen in die demokratischen Grundzusammenhänge, die demokratische Verfasstheit unserer Gesellschaft.“ Ohne Vertrauen gebe es kein funktionierendes demokratisches Zusammenleben. Gerade in der Corona-Zeit und bei den Lockdowns sei spürbar geworden, dass Menschen die Gemeinschaft bräuchten, so Stelzer. Der aktuelle rege Zustrom zu Veranstaltungen und das wieder aufblühende soziale Leben in Vereinen und Pfarren gebe Hoffnung, „dass wir eine Art Grundfeste haben, die Gemeinschaft ermöglicht“.
Die Grundsätze des Vertrauens Institutionen gegenüber seien ähnlich wie im zwischenmenschlichen Bereich: „Ich brauche jemanden, der mir zuhört, mich ernst nimmt, der es ehrlich mit mir meint.“ Vertrauen habe oft auch damit zu tun, dass man sich Klarheit wünsche – was auf den ersten Blick als leichter Widerspruch zu demokratischen Gestaltungen erscheinen könne. Häufig sei nämlich die schnelle, klare Antwort in einer Demokratie nicht auf den ersten Blick ersichtlich. „Wir müssen gerade in diesen Tagen eindrücklich erleben, dass uns ausschließlich das demokratische Zusammenleben unsere Freiheit und das Leben in Frieden garantiert. Die verlockende Erwartung, dass es einen oder wenige gibt, die schnell Klarheit schaffen können, offenbart häufig die zweite, furchtbare Seite der Medaille: dass das allzu schnell ins Verderben führen kann. Daher ist das Zusammenführen vieler Meinungen und Ansichten der einzige und sichere Weg. Die Grundlage unseres demokratischen, vertrauensvollen Zusammenlebens ist die Möglichkeit und der Wille zum Miteinander.“ Die heurige Ökumenische Sommerakademie sehe er als besondere Ermutigung, sich gemeinsam an einem vertrauensvollen Zusammenleben zu orientieren, so Stelzer.
Niemand: Thema trifft den Puls gesellschaftlicher Problematik

Rektor Dr. Christoph Niemand von der Katholischen Privat-Universität Linz brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass heuer wieder eine „Sommerakademie reloaded“ möglich sei. „Das Vorbereitungsteam hat sich bemüht, ein Thema zu finden, das den Puls gesellschaftlicher Problematik heute trifft – und ich denke, das ist uns gelungen.“ Es sei Aufgabe von Universitäten, neben Forschung und Lehre als „dritte Mission“ mit ihrer Kompetenz direkt in die Gesellschaft hineinzuwirken. Die Katholische Privat-Universität Linz freue sich, das Veranstaltungsmanagement für die Ökumenische Sommerakademie zur Verfügung stellen zu können. Das Programm der heurigen Sommerakademie spanne sich von Philosophie und Soziologie über Politologie, Psychologie und Theologie bis hin zu Spiritualität und sei mit hochkarätigen Referent:innen besetzt, so Niemand.
Bauinger: Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit als zentrale Bestandteile von Vertrauen
Superintendentialkuratorin Mag.a Renate Bauinger brachte in ihren Begrüßungsworten ihre Erfahrungen und ihr Wissen als (Religions-)Pädagogin ein. Sie berichtete, sie habe Studierende der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz gefragt, was für sie Vertrauen bedeute. Die Antworten: „Vertrauen ist die Basis für eine funktionierende Beziehung oder Freundschaft. Vertrauen führt Menschen zusammen, aber macht sie auch verletzbar. Vertrauen bedeutet, von etwas überzeugt zu sein, das Gefühl zu haben, mich auf jemanden verlassen zu können. Vertrauen in Gott und in mein Leben bedeuten für mich zu glauben, dass es einen Grund für jegliche Erfahrung gibt, dass alles gut wird.“ Vertrauen sei ein Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen, beruhe auf der Erfahrung der Vergangenheit und sei gleichzeitig zukunftsbezogen. Zu vertrauen, sei befreiend, berge aber auch immer ein gewisses Risiko, so Bauinger, die es für wichtig erachtet, diese „bipolare Ausrichtung des Begriffes“ nicht aus dem Blick zu verlieren: Vertrauen erscheine vordergründig gut, könne aber auch missbraucht und verletzt werden.
Gefragt, wem sie vertrauen, nannten die Studierenden Partner:innen, Eltern, Familie, Freund:innen, sich selbst und Gott. „Artefakte wie Geld, Gesetze, Verträge, Medien fehlen in den Antworten gänzlich“, so Bauinger. Geprägt werde das Vertrauen-Können dem Psychoanalytiker Erik Erikson zufolge zunächst durch die frühkindliche Mutter-Kind-Beziehung. Das Gefühl des Sich-verlassen-Könnens habe eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung zur Folge. Dieses Urvertrauen – oder im Gegenteil Urmisstrauen beim Erleben von Unzuverlässigkeit – bleibe ein Leben lang bedeutsam. Dies stütze Julian Rotters soziale Lerntheorie der Persönlichkeit, wonach jeder Mensch durch individuelle Interaktionserfahrungen mit der Umwelt geprägt ist. Für Rotter seien Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit zentrale Bestandteile von Vertrauen. Je mehr positive Vertrauens-Erfahrungen ein Individuum gemacht habe, desto vertrauensvoller könne es auf Interaktionspartner:innen zugehen.
Ćilerdžić: "Interessante ökumenische Fragestellung über das Fundament unseres Zusammenlebens"
Andrej Ćilerdžić, Bischof der Serbisch-orthodoxen Kirche Österreich-Schweiz-Italien und Malta, betonte, er begrüße als Repräsentant des Ökumenische Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ), der seit 2000 Mitveranstalter der Ökumenischen Sommerakademie sei, das „angeregte gemeinsame Nachdenken über das Thema Vertrauen, weil die interessante ökumenische Fragestellung über das Fundament unseres Zusammenlebens eine Hoffnung ausspricht, der wir uns anvertrauen können und dürfen“. Bei der Veranstaltung gehe es um Vertrauen als Kategorie menschlichen Daseins und um biblische Erzählungen von Vertrauen. Ebenso werde auf das frühere gegenseitige Misstrauen der Kirchen und die vertrauensvolle Entwicklung durch die ökumenische Bewegung eingegangen.
Er finde es „weise und klug“, die Ökumenische Sommerakademie in einem Kloster stattfinden zu lassen, so der Bischof. Wenn sich getrennte Kirchen entschließen würden, ihre Spaltung zu überwinden, gebe es immer vier Ebenen der Gegenüberstellung: die Ebene der Leitung, jene der Wissenschaft, jene der Hilfswerke und als vierte Ebene die Klöster. „Im klösterlichen Leben wurde das urchristliche Gut des christlichen Lebens bewahrt – das ist für alle christlichen Kirchen eine große Hoffnung, weil die ökumenische Bewegung davon lebt, dass es in unseren Kirchen etwas gibt, was uns zusammenschweißt“, betonte Andrej Ćilerdžić.
David: Pluralismusfähig werden und mehr Vertrauen wagen

Dr. Philipp David, Professor für Systematische Theologie / Ethik an der Justus-Liebig-Universität Gießen, gab in seinem Eröffnungsvortrag „Vertrauen als Grundbedingung menschlichen Daseins“ einen einführenden Überblick über das Tagungsthema und lieferte Bausteine für eine „kleine anthropologische Theorie des Vertrauens“. Als „Geländer“ dienten dabei die Fragen: Was ist die Bedeutung der „Ressource“ Vertrauen für Individuen und Gesellschaften? Wie entsteht Vertrauen? Was geschieht, wenn es fehlt? Was sind die Möglichkeitsbedingungen des Entstehens von Vertrauen?
Wie entsteht Vertrauen?
In einem ersten Schritt beschrieb David die heutige Lebenswelt in ihrem geschichtlichen Gewordensein anhand eines Beispiels. Er wählte dazu das niederländische Dorf Jorwerd, dessen Geschichte des Untergangs von 1945 bis 1995 der niederländische Historiker und Journalist Geert Mak in seinem Buch „Wie Gott verschwand aus Jorwerd“ nachzeichnet. War 1945 im landwirtschaftlich geprägten Dorf Jorwerd „die Welt noch in einer überschaubaren Ordnung“, war das Dorf 1995 merklich geschrumpft; durch den Siegeszug des Automobils, des Supermarkts und des Dienstleistungssektors lebten die meisten Einwohner „mit einem Bein in der Stadt“. Die meisten Läden „verloschen in Jorwerd wie eine Kerze“, 1994 sei die Kirche einer Stiftung für Denkmalschutz übergeben worden.
David betonte, Ende des 20. Jahrhunderts sei eine Kultur untergegangen, die jahrhundertelang prägend und vertraut gewesen sei. Die Merkmale eines „guten Lebens“ und eines „guten Menschen“ aus Sicht der Bauernkultur waren „eine große Anhänglichkeit an die Scholle; eine respektvolle Haltung gegenüber alten Gepflogenheiten; eine Beschränkung individueller Bestrebungen zugunsten von Familie und Gemeinschaft; ein gewisses Misstrauen gegenüber dem städtischen Leben, mit Wertschätzung vermischt; eine schlichte und bodenständige Ethik“, erläuterte David in Anlehnung an Mak. Dieses universale Wertesystem habe sich aus dem fortwährenden Umgang mit der Natur abgeleitet. Auch die Rolle der Religion habe sich selbstverständlich aus dem bäuerlichen Leben ergeben mit seinem Kreislauf von Geburt, Leben und Tod, den Mysterien der Natur und dem Zyklus der Existenz. Zweifel an der göttlichen Ordnung, die es oft genug gab, hingen mit dem vernichtenden Einfluss der Natur zusammen. Dies änderte sich in der Neuzeit: „Das immense Anwachsen der (Ver-)Sicherungssysteme versprach umfassende Sicherungs- und Entlastungseffekte und führte zu einer entgrenzten Versicherungsmentalität. Dank medizinischer Technik, technologischem Fortschritt und sozialer Sicherung festigte man den Eindruck, Tod, Katastrophen und Elend zu verbannen, unter Kontrolle zu bekommen oder jedenfalls an den Rand der Existenz zu drängen. Mit der Zeit führte dieses zu einer veränderten Haltung gegenüber der Ungewissheit im Allgemeinen und zum Schicksal eines jeden Menschen im Besonderen.“
Was sich in Jorwerd in den letzten fünfzig Jahren des 20. Jahrhunderts ereignet habe, finde sich nach den beiden Weltkriegen in ganz Europa, so David: „Eine Revolution der Lebens- und Arbeitsverhältnisse hat im Laufe von nur zwei Generationen über Jahrhunderte tragende Lebensformen, eingespielte Gewohnheiten und orientierende Traditionen zum Verschwinden gebracht. In Deutschland geht die Institution Kirche davon aus, dass ein Drittel ihrer Kirchengebäude in den nächsten dreißig Jahren zur Disposition steht. Nach der Projektion der Entwicklungen der Kirchenmitgliedszahlen ist bis 2060 insgesamt ein Rückgang von rund der Hälfte der Mitglieder der Evangelischen Kirche in Deutschland zu erwarten. Falls die Ergebnisse einer Jugendstudie aus dem Jahr 2019 stimmen, brauchen junge Europäer keine Religion und keinen Gottesglauben mehr. Kein oder wenig Vertrauen in religiösen Institutionen hätten demnach 86 Prozent der Befragten.“
Die beschriebenen komplexen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse müssten mitreflektiert werden, wenn man den Bedeutungsaufschwung des Themas Vertrauen und seinen aktuellen Stellenwert verstehen wolle, so der Vortragende. War in landwirtschaftlich geprägten Dorfgemeinschaften Vertrauen noch eng mit Vertrautheit verbunden, lasse sich nun in modernen Gesellschaften eine Trennung von Vertrauen und Vertrautheit beobachten. „Vertrauen wird unmöglich und verschwindet, wo die bisher tragenden Fundamente, also die Verlässlichkeitsannahmen, die Gewohnheiten und die Vertrautheiten, zerfallen. Argwohn hat Konjunktur: Wir leben im Zeitalter des Misstrauens. Dessen Parole lautet: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“
Was geschieht, wenn Vertrauen fehlt?
In ethisch-philosophischer Hinsicht habe man versucht, rechtes Vertrauen als menschliche Tugend festzulegen, als Mitte zwischen Vertrauensseligkeit und Vertrauensschwäche. Diese sittliche Hochschätzung des Vertrauens verfalle, wenn das ethisch gerechtfertigte Misstrauen, das vor Untreue und Vertrauensbruch schütze, wie in der gegenwärtigen Krisensituation zum alles beherrschenden, dominanten Prinzip aufsteige, wie David erläuterte: „Das führt zu einem gewohnheitsmäßigem Alles-hinterfragen-Müssen. Es wittert in allen Beziehungen von Vertrauen und in allen Versicherungen von Treue immer nur Lug und Trug. Eine solche Habitualisierung des Misstrauens führt zu einem methodisch forschenden Misstrauen, das nun zum Ausdruck von Wahrhaftigkeit avanciert. Eine solche Umwertung stößt auch das Ethos des Vertrauens um. Vertrauen wird zum Ausdruck von lebensschädlicher Schwäche, radikales Misstrauen zum Ausdruck rückhaltloser intellektueller Redlichkeit.“
Die Rede vom Vertrauensverlust, der alle menschlichen Beziehungen in Familie, Gesellschaft und Staat grundlegend und verderblich unterhöhle, sei derzeit in aller Munde. Allein mit der Aufforderung, man müsse verlorenes Vertrauen wiedergewinnen, sei es nicht getan, so David. Angesetzt werden müsse vielmehr bei der Frage: Woher stammt diese Krise und wodurch ist sie entstanden? David dazu: „Den Vertrauensschwund kann man als Symptom der Heraufkunft des immer noch angehenden Europäischen Nihilismus sehen. Nietzsche hatte am Ende des politisch, industriell und religiös revolutionären ereignisreichen und umheimlichen 19. Jahrhundert einen bisher nicht dagewesen Traditionsabbruch diagnostiziert, dessen Folgen erst in den nächsten zwei Jahrhunderten sichtbar werden würden. Wenn Nietzsches Diagnose stimmt, befinden wir uns noch mittendrin in diesen zwei Jahrhunderte währenden großen Umwälzungen.“
Längst habe dieses zerstörerische Misstrauen dazu beigetragen, das in Europa gewachsene (christliche) Gottvertrauen von Grund auf und nachhaltig zu zerstören. Das „Vulgärmisstrauen“, wie David es bezeichnet, hinterfrage alles und jeden: „Alles ist korrupt. Nichts hat Vertrauen verdient. Jede Verlässlichkeit und Treue in unserem Verhältnis zu Dingen und Menschen ist zerrüttet. Normal wäre es doch, wenn wir Vertrauen haben zur Festigkeit unseres Wohnhauses oder zur Zuverlässigkeit unseres Autos. Damit verbunden ist das Vertrauen in die Menschen, die Autos und Häuser bauen. Verbunden sind damit auch die Banken, die Kreditanstalten, bei denen wir unser Geld anlegen, oder die Kliniken, denen wir Leib und Leben anvertrauen. Sowie die Kirchen, die uns doch mit dem Evangelium zeigen wollen, dass auch eine andere Welt möglich ist.“ Ein solches Vertrauen würden Einzelne im operativen Geschäft verspielen. Derzeit sei ein Enthüllungsmechanismus zu beobachten, der „spektakulär darauf aus ist, Skandale aufzudecken“. David: „Solch ein Nachfragen ist berechtigt und bitter nötig, wenn es einem gesunden und kritischen Misstrauen entspringt. Es wird aber heillos und zerstörerisch, wenn es einseitig und überkritisch aus Sensationslust vorhandenes Vertrauen unterhöhlt, indem es auch wirklich ehrenhaften, selbstlosem und dem Gemeinwohl dienenden Verhalten dubiose Motive unterstellt. Ohne dass man einander Vertrauen schenkt, zerfallen Ehe, Familie und Freundschaft, Gesellschaft und Staat. Denn der heillos herrschende Argwohn des vulgären Misstrauens verwandelt funktionierende menschliche Gemeinschaften in die Hölle gegenseitiger Belauerung, Verdächtigung, Diffamierung und Entwürdigung.“
Noch tiefer als das Vulgärmisstrauen schneide die „Kunst des radikalen Misstrauens“ in den Traditionsbestand des Vertrauens ein. Dabei gehe es „um die Folgen für Philosophie und Moral, wenn sie auf ihren ‚höchsten Gegenstand‘ Gott und das Gute und Wahre verzichtet. Kurz gesagt: Das Vulgärmisstrauen vergiftet alles Vertrauen von Mensch zu Mensch. Nihilistisches Misstrauen erstickt das platonisch-christliche Gottvertrauen.“
Was sind die Möglichkeitsbedingungen des Entstehens von Vertrauen?
Sei es vor diesem Hintergrund überhaupt noch möglich, zwischenmenschliches Vertrauen und Gottvertrauen aufzubauen? Davids erster Befund: Das Vertrauen werde in der Moderne nicht überflüssig und durch Rationalität ersetzt – im Gegenteil: „In der modernen Welt wächst mit zunehmender Rationalität die Notwendigkeit des Vertrauens. Im Vergleich zur Lokalität des wechselseitigen Vertrauens in der Dorfgemeinschaft, in der jeder sich auf den anderen verlassen muss, hat sich die Notwendigkeit des Vertrauens globalisiert. Das macht Vertrauen unübersichtlicher, aber nicht unmöglich.“ Natürlich seien Hinterfragen, Kritik und eine gesunde Portion Misstrauen „unverzichtbar, ja lebenswichtig“. Misstrauen schütze vor Illusionen, blindes Vertrauen führe ins Verderben. David: „Klar ist allerdings auch, dass das totale Misstrauen und die totale Kontrolle nicht menschenmöglich und auch nicht wünschenswert ist. Jeder einzelne Mensch muss mehr vertrauen, als er rational kontrollieren kann. Dass solch ein Vertrauen auch enttäuscht werden kann, muss man wissen und in seine Lebenserfahrung einbauen.“
Davids zweiter Befund: Kritik als Kunst der Unterscheidung dessen, „was daseinsmäßig tragfähig und tauglich ist und was nicht“, zerstöre Vertrauen nicht. Anders als das „Vulgärmisstrauen“ lehre kultivierte Kritik, „wieder zu unterscheiden, wer oder was Vertrauen verdient und wer oder was nicht“. Zur sachgerechten Einübung und Ausführung der kritischen Kunst der Unterscheidung sei das Selbstdenken wesentliche Voraussetzung, wie David betonte. „Damit man nicht abgeschmackten Urteilen ungeprüft folgt, die andere für einen gefällt haben oder die man selbst unüberlegt getroffen hat, ist ein kluges und verantwortungsbewusstes Abschmecken der Lebens-, Denk- und Handlungsoptionen und ihrer möglichen Folgen hilfreich. Das scheint mir eine der wichtigsten Aufgaben zu sein, vor die uns das Leben in unserer Zeit stellt.“
David plädierte dafür, wieder mehr Vertrauen zu wagen, um sich nicht selbst heillos in einer Welt des Misstrauens zu verstricken. „Vertrauen nimmt dabei den Charakter des Wagnisses in Anspruch. Vertrauen schenken und Sich-Trauen verlangt einen Sprung, der alle Absicherungen und Garantien überspringt. Denn wir wissen nicht und können es auch beweiskräftig vorhersagen, ob das geschenkte Vertrauen belohnt oder enttäuscht wird. Offenkundig ist so ein Sprung über rationale Absicherungen und pragmatische Versicherungen hinaus in ein Ungesichertes und Risikoreiches hinein mehr als unzeitgemäß. Zeitgemäß wäre eine Versicherung gegen jedes Restrisiko. Die Versicherungspolice – nicht mehr das Dank- und Bittgebet – kompensiert die Ungewissheit und Kontingenz des Daseins.“
Davids dritter Befund: Gottvertrauen könne nicht quasi „per Knopfdruck“ wiederhergestellt werden. Christlicher Glaube sei „kein Rechnen mit der göttlichen Gnade im Allgemeinen, sondern das je konkrete Vertrauen auf die je konkrete Zueignung von Vergebung – und die Kraft und der Mut, die ermöglicht, zum Wirklichwerden des Guten beizutragen“. Glaube als Gottvertrauen verlasse sich zuerst und zuletzt auf die Verlässlichkeit der Treue und Wahrheit des transzendenten Schöpfers. „Gott wird hier als einheitlicher Ursprung der Welt verstanden. Einer Welt, die sich uns heute in einer schillernden Vielfalt zeigt. Der Pluralismus ist die unverkennbare Signatur unserer Zeit und Lebenswelt. Die ethische Aufgabe, vor die wir gestellt sind, heißt: pluralismusfähig zu werden. Also sich orientieren können in einer unübersichtlich gewordenen Welt und Gesellschaft.“
Die Risse und Differenzen würden nicht wieder verschwinden; es gelte, mit ihnen zu leben und Mehrdeutigkeiten aushalten zu lernen. Dazu könne auch die Religion anleiten, zeigte sich David überzeugt, „wenn in ihr der Sinn für Komplexitäten und Kontingenzen und der Umgang mit ihnen gebildet wird. Und die Theologie vermag als die aufgeklärte Reflexionsinstanz von Religion zu einer begründeten Unterscheidungsfähigkeit und Urteilskraft anzuleiten.“ Eine solche Theologie wäre nicht nur eine besonnene Deutungsmacht in der Weiterentwicklung der christlichen Religion, sondern auch „eine aktive Gestalterin ihrer Zukunft und gesellschaftspolitischen Prägekraft“.
Davids Fazit: „Ob das Zusammenleben im Widerstreit der Weltanschauungen gelingt, wissen wir nicht. Die Fundamente und ihre inhaltlichen Begründungen des Zusammenlebens müssen im Wertepluralismus des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates immer wieder neu errungen werden. Wir haben aber keine andere Wahl, als es zu wagen und darauf zu vertrauen, dass es gelingen kann. Das Gebot der Stunde – und damit ein Eckstein einer kleinen anthropologischen Theorie des Vertrauens – heißt jedenfalls: Mehr Vertrauen wagen!“
Wetzel: Vertrauensverlust ist nicht grundlegend, sondern differenziert zu sehen

Jan Wetzel, M. A., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, beleuchtete in seinem Eröffnungsvortrag „Vertrauen und Autorität – Transformationen demokratischer Selbstverhältnisse“ Vertrauen als Beziehung, die gesellschaftlich unterschiedlich ausdifferenziert ist. Dies illustrierte Wetzel mit Auszügen von Ergebnissen der Vermächtnisstudie, in der auf Basis repräsentativer Umfragedaten erhoben wurde, was die Befragten über sich im Vergleich zu ‚den anderen‘ denken. Daran schloss er Überlegungen zum Verhältnis von Vertrauen und Autorität in demokratischen Systemen an.
Wetzel hat gemeinsam mit Jutta Allmendinger das Buch „Die Vertrauensfrage. Eine neue Politik des Zusammenhalts“ (Dudenverlag) verfasst, das im Frühjahr 2020 ist – kurz vor der Pandemie. Ähnlich sei es mit der Anfrage für den Vortrag gewesen: „Bereits da gab es genügend Themen, um über Vertrauen und gesellschaftlichen Zusammenhalt nachzudenken. Neben dem Klimawandel, der Digitalisierung und dem Wandel des Arbeitsmarktes, dem demografischen Wandel war als akute Krise die Pandemie hinzugekommen, mit 24. Februar dann die Invasion Russlands in der Ukraine. „Egal, welche der Krisen wir nehmen, die Debatte dreht sich um die Frage des Vertrauens. Insofern könnte das Thema dieser Veranstaltung kaum aktueller sein. Vertrauen in den Staat, ob er das alles wird managen können. Vertrauen in die Mitmenschen, ob sie sich angemessen, im Hinblick auf das Gemeinwohl verhalten. Und auch Selbstvertrauen, ob man mit den vielen ‚Zeitenwenden‘ wird umgehen können.“
Vertrauen als selbsterfüllende Prophezeiung
Er wolle versuchen, Vertrauen als „soziologische Brille“ näherzubringen, so Wetzel, der sich in seinen Ausführungen auf Georg Simmel (1858 – 1918), einen der Gründerväter der Soziologie, stützte. Dieser habe vor 100 Jahren geschrieben, also in einer Zeit, die von ungeheuren Umbrüchen geprägt war: „Von der Durchsetzung kapitalistischen Wirtschaftens, von der ungeheuren neuen Machtfülle der Nationalstaaten und ihrer Bürokratien, von der Urbanisierung, vom Massenkonsum.“ Der Mensch sei in immer vielfältigere soziale Kreise eingebunden gewesen, was die Komplexität gesteigert habe. Zusammengehalten werde dies nach Simmel vom Vertrauen, das er definiere als „Vor- oder Nachform des Wissens um einen Menschen“. Wetzel dazu: „Das heißt, Vertrauen kann als Vorurteil unseren eigentlichen Kontakt prägen – ‚So, wie der schon aussieht, kann man dem nicht vertrauen‘, oder als Reflexion die Beziehung verinnerlichen: ‚Den kenne ich schon lange, den kann man vertrauen‘.“
Vertrauen sei also eine „Hypothese künftigen Verhaltens, die sicher genug ist, um praktisches Handeln darauf zu gründen“, und habe eine eigenartige Zeitlichkeit: „Ich mache eine Vorhersage über das Verhalten in der Zukunft, diese Vorhersage kann jetzt weder bestätigt noch widerlegt werden, und ermögliche damit aber etwas, das jetzt geschieht“ und das ohne Vertrauen unmöglich wäre, erläuterte der Vortragende. „Die langfristig gesicherte Existenz, die mir ermöglicht, den Kredit zurückzuzahlen, habe ich erst durch den Kredit stabilisieren können. In die neue, herausfordernde Arbeitsstelle konnte ich erst mit Mut ‚hineinwachsen‘, weil mir das jemand zugetraut hat. Eine Ehe kann die schlechten Tage erst dadurch überstehen, weil man sich vorher im Vertrauen gesagt hat: Wir werden das schaffen, auch wenn wir vorher noch nicht genau wissen, wie. Gelingendes Vertrauen ist auch immer eine selbsterfüllende Prophezeiung.“ Dabei bedeute Vertrauen auch immer Risiko: „Die Hypothese auf das künftige Verhalten, mit Simmel gesprochen, kann sich als falsch herausstellen. Oder positiv formuliert: Vertrauen ist immer auch ein Geschenk.“
Vertrauen braucht Wissen
Vertrauen sei aber nicht blind, sondern basiere auf Wissen, wie Wetzel mit einem Zitat von Simmel unterstrich: „Der völlig Wissende braucht nicht zu vertrauen, der völlig Nichtwissende kann vernünftigerweise nicht einmal vertrauen.“ Derjenige, der volle Kontrolle habe, braucht nicht zu vertrauen; derjenige, der überhaupt keine Kontrolle habe, könne vernünftigerweise nicht einmal vertrauen. Vertrauen ergebe sich also beziehungshaft aus dem Zusammenspiel von Vertrauen und Kontrolle. „Es heißt also, anders als es das Sprichwort sagt, nicht: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Vielmehr braucht Vertrauen Kontrolle, und, weil Kontrolle nie vollständig ist, Kontrolle braucht auch Vertrauen.“
Differenziertes Institutionenvertrauen
Wetzel unterschied in seinem Vortrag zwischen Vertrauen, das an eine persönliche Beziehung gebunden ist – zwischen Freund:innen, in der Familie, in der Nachbarschaft – und nichtpersönlichen Vertrauensbeziehungen. In der Forschung werde weiters zwischen „generalisiertem Vertrauen“ und „Institutionenvertrauen“ unterschieden. Zum Institutionenvertrauen merkte Wetzel an, es gebe keine einfache Spaltung der Gesellschaft, wie das seit einigen Jahren diagnostiziert werde: „Die Urteile über die Gesellschaft sind differenziert, nach den Bereichen, über die gesprochen wird, aber auch, nach den Voraussetzungen, die die Menschen mitbringen.“ So sei deutschen Studien zufolge das Vertrauen in die Wissenschaft, in Justiz und Gerichte, die Polizei, auch in NGOs und Gewerkschaften hoch, im mittleren Bereich seien Bundestag und Bundesregierung angesiedelt, weit unten dann Banken, Massenmedien, Parteien und auch Kirchen. Es gebe also keinen „grundlegenden Vertrauensverlust“, so Wetzels Befund. Es zeige sich jedoch, dass Menschen, die sich nicht mehr als Teil einer gemeinsamen gesellschaftlichen Entwicklung verstünden, weniger Vertrauen hätten.
Generalisiertes Vertrauen
Im Zusammenhang mit dem „generalisierten Vertrauen“ nannte Wetzel Ergebnisse aus der „Vermächtnisstudie“, einer Studie, die seit 2014 mehrfach in Deutschland erhoben wurde, in Kooperation des WZB mit dem Umfrageinstitut infas in Bonn zusammen mit der Wochenzeitung DIE ZEIT. „Ausgangspunkt war die Überlegung, dass wir zwar jede Menge Zukunftsstudien haben, in denen Expertinnen und Experten Auskunft darüber geben, wie die Welt in so und so vielen Jahren sein wird. Was fehlt, sind Studien, die differenziert ganz normale Leute nach ihren Wünschen fragen.“ Mehrere Dimensionen wurden dabei abgefragt: Was tut man selbst? Was wünscht man sich für die Gesellschaft? Was glaubt man, wie es tatsächlich kommen wird? Über Umwege sei man durch diese Fragen zum Vertrauen gekommen: „In vielen Bereichen haben wir gesehen, dass den Abstand, den ich zwischen mir und anderen sehe – ich mache das so, die anderen so – moderiert wird durch das generalisierte Vertrauen. Kurz: Wenn ich generell eine bessere Meinung von anderen habe, denke ich auch, dass sie sich ähnlich verhalten wie ich“, berichtete Wetzel.
Interessant sei in diesem Zusammenhang auch, dass es eine Varianz zwischen den Antworten auf unterschiedliche Fragen gebe: „Das erste Ergebnis: In vielen zentralen Bereichen der Gesellschaft, sei es Familie, Gesundheit oder Arbeit – glauben die Menschen, dass ihre eigenen Einstellungen denen der meisten anderen Menschen entsprechen. Und das stimmt auch, denn die meisten anderen sagen das genauso. Das spricht gegen Thesen eines Kulturkampfs, eines Auseinanderdriftens der Gesellschaft auf der Wertebene.“ Das zweite Ergebnis: Gehe es um ein konkretes Verhalten, seien die Menschen skeptischer. Wetzel erläuterte dies an einem Beispiel: „Wenn wir danach fragen: Wie wichtig ist es Ihnen, eigene Kinder zu haben, sagen über 80 Prozent: ja. Dieselben Werte finden wir, wenn wir danach fragen, wie wichtig es ist, sich für seine Kinder aufzuopfern, also etwa umzuziehen oder den Job zu wechseln. Dort finden wir auch eine starke Norm: Man sagt, die anderen sehen das ebenso wie man selbst. Aber geht es ums Kinderkriegen, sieht das Bild anders aus. Kinder zu haben sieht man in der Gesellschaft weniger wichtig als bei einem selbst. Eine falsche Beobachtung. Wir glauben, das hat etwas mit den strukturellen Bedingungen zu tun. Man hat den Eindruck, ein Kind auf die Welt zu bringen mit dem eigenen Anspruch, das auch wirklich gut zu machen, überfordert viele, sodass sie lieber darauf verzichten.“
In den Antworten werde aber „kein rabenschwarzes Bild der anderen“ gezeichnet, sondern es komme zum Ausdruck: Ich weiß nicht, wie die anderen sind. Die anderen, so das Gefühl, würden sich nicht frei entscheiden, sondern seien durch äußere Zwänge beeinflusst „Woher man das weiß? Durch das eigene Erleben, das bei den anderen freilich noch viel schlimmer gegeben ist. Und so kann man den anderen nicht vertrauen: Auch wenn sie die eigenen Werte vertreten, so werden sie sie doch nur leben, wenn die Bedingungen stimmen, und vielleicht bei der nächsten Krise schon wieder fallenlassen“, so Wetzel.
Die „Autoritätslücke“
Im Zusammenhang mit dem Vertrauen habe sich ihm ein Begriff aufgedrängt, den er die „Autoritätslücke“ nenne, so Wetzel. Gemeint sei: Wer setzt politische Entscheidungen durch? Auch dazu gebe es in der Vermächtnisstudie Fragen. Das Ergebnis: „Die meisten Menschen haben das Gefühl, mehr zu tun, verantwortungsvoller, informierter zu sein als andere. Sie haben das Gefühl, die anderen verhindern notwendige Änderungen.“ Zur Durchsetzung eines bestimmten Verhaltens, zur Änderung von Gewohnheiten brauche es Autorität – ein schillernder Begriff, der fälschlich „in der Nähe des Autoritären, gar des Autoritaristischen“ stehe. Autorität gründe sich vielmehr auf legitime Herrschaft und schließe ein Vertrauen in die Autorität ein. Wetzel zitierte in diesem Zusammenhang Heintich Popitz, der auf die psychosozialen Eigenheiten der Beziehung zwischen Herrschenden und Unterworfenen aufmerksam gemacht habe. Die Wirkung von Autorität reiche nämlich über die „bloße Verhaltensanpassung“ hinaus und führe zur Übernahme der Perspektiven und Kriterien der Autoritätsperson. Der grundlegende Prozess dafür sei Anerkennung. Eben diese psychosoziale Dynamik sei in der Pandemie zu beobachten gewesen, so Wetzel: „Das Virus ist mit dem bloßen Auge nicht zu sehen. Der Staat musste also darauf setzen, dass die Bevölkerung seine wissenschaftlich fundierte Perspektive übernimmt. Die politische Kontrolle des Infektionsgeschehens war nur möglich durch eine Anpassung der Risikowahrnehmung im Alltag und ihre Übersetzung in allgemeingültige Verhaltensnormen durch soziale Kontrolle.“
In der Pandemie hätte man die sogenannten „Querdenker“ kennengelernt, eine Gruppe, die eine solche Autorität grundsätzlich ablehne. Zahlenmäßig sei sie eine politisch eher unbedeutende Gruppe. Die Faszination, die massenmediale Verstärkung der Proteste und die Irritation, die sie in der Politik erzeugen, sei deshalb anders zu erklären. In den Debatten um sie spiegle sich vielmehr die Frage, in welchen Formen die westlichen Gesellschaften das Handeln ihrer Bevölkerung koordinieren könne, um die existenziellen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. „Wie das geht, und welche Rolle Vertrauen dabei spielt, das scheint mir eine der Knackpunkte gesellschaftlicher Entwicklung zu sein, über die wir differenzierter und ernsthafter sprechen müssen“, so Wetzel, der sich in dieser Frage gegen eine Vereinfachung wehrte. „Sie erinnern sich vielleicht an die Momente in der Pandemie, in der eine sehr überzeugte Seite der Streitenden fest davon überzeugt war, die Lage vollständig zu wissen, und daraus ableitete, nun müssten alle ‚der Wissenschaft‘ vertrauen. Wer – mit wissenschaftlich fundierten – Gründen Zweifel anbrachte, wurde schnell ins Lager der Wissenschaftsleugner gestellt.“
Gegendemokratie und Antidemokratie
Im Prinzip gehe es darum, zu verstehen, in welchen konkreten institutionellen Beziehungen Vertrauen und Kontrolle in der Demokratie zusammenspielen, um Autorität zu begründen. Wetzel meinte unter Bezugnahme auf den Soziologen Richard Sennett, Demokratie sei idealtypisch „ein System von checks and balances, von Vertrauen und Misstrauen, von Vertrauen und Kontrolle“. Der französische Politikwissenschaftler und Historiker Pierre Rosanvallon habe den Begriff der „Gegendemokratie“ geprägt. Er mache darauf aufmerksam, dass das demokratische Versprechen „von den jeweils historisch konkret existierenden Systemen niemals vollständig umgesetzt“ werden könne. Vor diesem Hintergrund zeige Rosanvallon, dass „die Gegendemokratie ein natürlicher Teil von Demokratien ist. Gegendemokratie nicht als Anti-Demokratie, sondern als mehr oder weniger wildes Geschehen außerhalb der offiziellen Institutionen von Regierung und Parlament, Recht und Verwaltung. Die Ambivalenz ist nun: Das kann Demokratien stärken und hat sie immer wieder gestärkt. Gleichzeitig kann sie zur Antidemokratie werden.“
Die Bielefelder Politikwissenschaftlerin Priska Daphi habe in ihren Untersuchungen von Massendemonstrationen in den letzten 20 Jahren zwei Typen identifiziert. Insgesamt ließen sich nämlich beim Blick auf den Massenprotest „insgesamt keine klaren soziodemografischen Gruppen identifizieren, in dem Sinne, dass die Jüngeren gegen die Macht der Alten, die Armen gegen die Macht der Reichen demonstrieren würden“. Stattdessen habe Daphi zwei Gruppen gefunden, die sich nach ihrer Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit, nach ihrer Zufriedenheit mit der Demokratie, und nach ihrem Vertrauen unterscheiden würden: die „disenchanted“ und die „confident“, also einerseits die enttäuschten oder desillusionierten und andererseits die zuversichtlichen, vertrauensvollen Kritikerinnen und Kritiker.
Wetzel abschließend: „Ich glaube, dass diese Unterscheidung uns dabei helfen kann, gesellschaftliche und politische Auseinandersetzungen zu navigieren. Ist der Protest, ist die Kritik, ist der Ruf nach Kontrolle ein Versuch der ‚Demokratisierung der Demokratie‘? Oder zielt sie bis hin zur autoritären Durchsetzung dessen, was man jeweils für den Volkswillen hält, also auf eine Gesellschaft totaler Kontrolle, ohne Vertrauen?“
Tag 2 und 3 der Sommerakademie
Am Donnerstag, 14. Juli 2022 widmete sich MMag.a Dr.in Katharina Stainer-Hämmerle. Politikwissenschafterin und Fachhochschulprofessorin für Public Management an der FH Villach, dem Thema "Unsere Welt am Wendepunkt. Wie Krieg und Pandemie die Demokratie verändern". Prim.a Dr.in Adelheid Kastner, Psychiaterin und Vorständin der Klinik für Psychiatrie mit Forensischem Schwerpunkt am Kepler Universitätsklinikum Neuromed Campus, referierte zum Thema "Vom Vertrauen und seinen Grenzen". MMag.a Dr.in Regina Polak, MAS, Associate Professor für Praktische Theologie an der Universität Wien, beleuchtet das Thema "Vertrauensverlust als Menetekel für die Kirche". "Von der Sehnsucht der Psalmen, vertrauen zu dürfen": So lautet der Titel des Referats von Dr.in Suanne Gillmayr-Bucher, Professorin für alttestamentliche Bibelwissenschaft an der Katholischen Privat-Universität Linz.
Am Freitag, 15. Juli 2022 referiert Sr. Mag.a Dr.in Melanie Wolfers SDS, Theologin, Philosophin, Autorin, Podcasterin und Speakerin, zum Thema "Vom schönen Wagnis, jemandem zu vertrauen".
Den Abschluss der Tagung bildet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Kirchen auf dem Weg des Vertrauens“ mit Bischof Dr. Manfred Scheuer (Katholische Kirche in Oberösterreich) und Bischof Andrej Ćilerdžić, (Serbisch-orthodoxe Kirche Österreich-Schweiz-Italien).
Ökumenische Sommerakademie
Seit dem Jahr 1999 beschäftigt sich die Ökumenische Sommerakademie mit Fragen, die die Menschen aktuell bewegen und bei denen sie auch Antworten von Theolog:innen und Kirchen erwarten. Die Themen sind breit gestreut und reichen von Politik und Ökonomie über Gentechnik, Hirnforschung und digitale Revolution bis zu existentiellen Fragen der einzelnen Menschen bzw. der Gesellschaft.
Die 23. Ökumenische Sommerakademie findet von 13. bis 15. Juli 2022 im Kaisersaal des Stiftes Kremsmünster statt. Die Vorträge und Diskussionen sind öffentlich zugänglich. Veranstalter:innen sind die Katholische Privat-Universität (KU) Linz, der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich, das Evangelische Bildungswerk Oberösterreich, die Linzer KirchenZeitung, das Stift Kremsmünster, die Religionsabteilungen des ORF in Fernsehen und Hörfunk und das Land Oberösterreich. Medienpartner sind der ORF Oberösterreich und die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN). Organisiert wird die Ökumenische Sommerakademie von der KU Linz.
14.7.2022/Diözese Linz/HE
Das KU_biläum wird unterstützt von