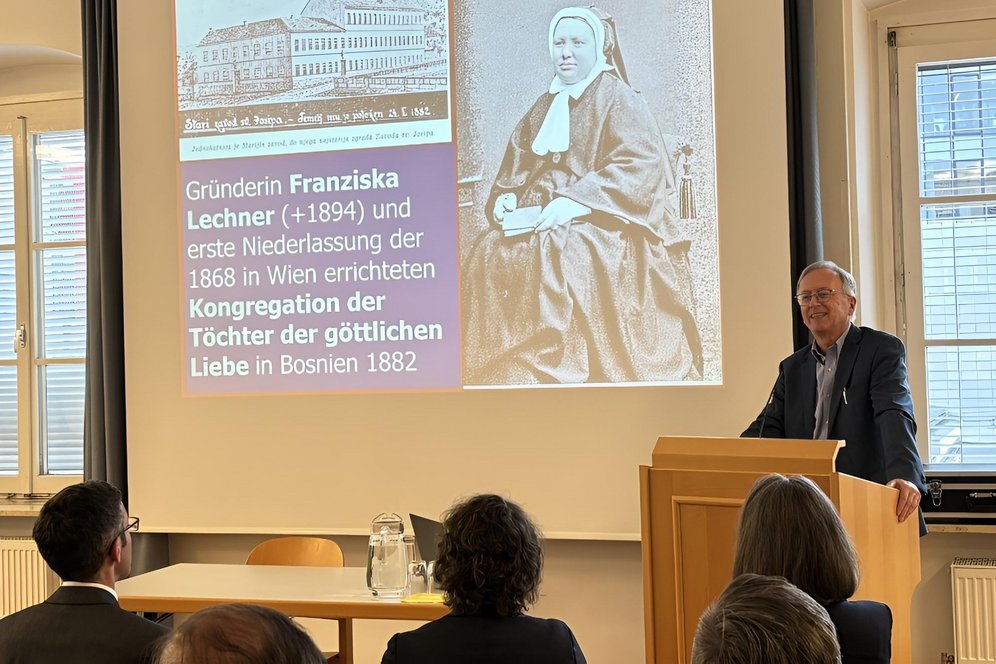Tagung ARGE Ordensarchive in Linz: Ordensleute im Nationalsozialismus.

Ziel der Tagung war es, insbesondere in jenen Ordensgemeinschaften, in denen bislang das Thema aus unterschiedlichen Gründen wenig Aufmerksamkeit erhielt, ein Problembewusstsein zu schaffen und Recherchen sowie eine ordensgeschichtlich fundierte, differenzierte Aufarbeitung anzuregen, die an Opfer erinnert und auch Täter benennt.
Die diesjährige Tagung lieferte nicht nur wertvolle Impulse für die Archivpraxis, sondern verdeutlichte auch die bleibende Relevanz historischer Verantwortung – gerade im Hinblick auf den Wert von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gewissensfreiheit in der Gegenwart.
Zwischen Loyalität und Widerstand
In seinem Vortrag zeichnete der Historiker Rupert Klieber (Professor i.R. am Institut für Historische Theologie an der Universität Wien) ein facettenreiches Bild vom Verhalten der Ordensgemeinschaften im Dritten Reich. Der Nationalsozialismus bedeutete für viele Klöster Verfolgung, Enteignung und Existenzbedrohung. So wurden ab 1938 insgesamt 214 der rund 1.400 österreichischen Ordensniederlassungen geschlossen (ca. 15 %), darunter 26 traditionsreiche Stifte.
1931 gab es in Österreich rund 5.600 Ordensmänner in 37 Gemeinschaften und rund 16.700 Ordensfrauen in 57 Gemeinschaften. Klieber differenzierte das Verhalten der Ordensleute in fünf Typen:
- Regime-Befürworter
- Pastoral-Idealisten (suchten das Gespräch mit den Nationalsozialisten)
- Sich-Dreinfügende oder „Die trotz allem Loyalen“ (größte Gruppe)
- Punktuell Widerständige
- Regime-Gegner (ca. 300 Personen in Befreiungsbewegungen)
„Ordensgeschichte in der NS-Zeit ist weder eine reine Opfer - noch eine reine Heldengeschichte. Der Widerstand bei Ordensleuten war lauter und opferreicher als in anderen Bereichen. Ordensfrauen und -männer streuten indirekt Sand ins Getriebe und bewahrten geistliche Inseln“, resümierte Rupert Klieber und gab den teilnehmenden Archivar:innen einen Tipp auf den Weg: „Achten Sie auch auf Dokumente in der Zeit vor 1938, denn relevante Sündenfälle sind oft schon vorher passiert. Und eines ist sicher: Je länger die Forschungsarbeiten laufen und je mehr Archive geöffnet werden, desto komplexer wird das Bild.“
Erinnern als geistliche Praxis
Einen anderen Zugang wählte P. Ewald Volgger OT (Professor für Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie an der KU Linz), der die liturgische Erinnerungskultur des Deutschen Ordens vorstellte. Angestoßen durch die Auseinandersetzung mit Leid, Verfolgung und Auflösung während totalitärer Systeme entstand das „Weiße Buch“: Nekrologium. Martyrologium des Deutschen Ordens. Das Nekrologium einer Ordensgemeinschaft ist ein täglich verwendetes Instrument der Ordensspiritualität im Gedenken an die Toten. Das Besondere an dem Nekrologium des Deutschen Ordens ist, dass es Kurzbiografien und Martyrologium von Ordensmitgliedern enthält, die unter totalitären Diktatoren litten oder ermordet wurden. Eingebettet in das tägliche Totengedenken soll dieses Projekt nicht nur dokumentieren, sondern auch spirituelle Tiefe schaffen: „Wir gedenken nicht nur der Toten, sondern würdigen ihr Leben als Glaubenszeugnis.“
Die sorgsam gestalteten Biografien umfassen ein bis zwei Seiten und sind eingebettet in die jeweilige Zeitgeschichte – ein bleibendes Zeichen bewusster Erinnerung, das über Provinzgrenzen hinweg Resonanz findet.
Der Auftrag für dieses besondere Nekrologium kam direkt von der Generalleitung. Und auch die Gestaltung wurde nicht dem Zufall überlassen: Ein weißer Leineneinband mit dem schwarzen Ordenskreuz. Der Einband erinnert an das Tuch, in das Verstorbene des Ordens gehüllt werden – es ist ebenfalls weiß mit einem schwarzen Kreuz. Auch ein eigenes Gedenkkreuz wurde von Künstler Herbert Friedl erschaffen.
Biografische Ambivalenzen: Der Fall P. Petrus Franz Mayrhofer
Wie komplex einzelne Lebenswege in dieser Zeit verlaufen konnten, zeigte Birgit Kirchmayr (Professorin am Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der JKU Linz) am Beispiel von P. Petrus Franz Mayrhofer OSB aus dem Stift Kremsmünster. Mayrhofer wurde 1939 wegen angeblichen Kanzelmissbrauchs verhaftet, später vorzeitig entlassen – doch seine Rolle bleibt ambivalent. So war er in den Jahren danach offenbar in die Verwaltung von Kunstbeständen der NS-„Führersammlung“ („Sonderauftrag Linz“) eingebunden und geriet nach 1945 in amerikanische Internierung. Überlieferte Predigten aus dieser Zeit zeugen von einer fragwürdigen „Opfer-Täter-Umkehr“.
Diese Forschungsarbeit zeigt, wie schwierig und komplex Biografien in der Zeit des Nationalsozialismus sein können und welche Ambivalenzen und Schattierungen heute zutage treten. Sie zeigt, wie wichtig verantwortungsvolle Biografiearbeit ist, aber sie zeigt auch die Grenzen auf – nämlich dann, wenn Quellen fehlen. „Wichtig ist es, in der historischen Forschung mit Sensibilität heranzugehen und Ambivalenzen auch zuzulassen“, sagte Kirchmayr in ihrem Vortrag. Im Fall der Biografie von P. Petrus Mayrhofer bleiben Ambivalenzen, Brüche und Leerstellen: Was passierte in der Haft 1939/40? Warum wurde er frühzeitig freigelassen? War er tatsächlich Gestapo-Konfident und war er dies unter Druck/Erpressung? Warum waren seine eigene NS-Verfolgung und Gefangenschaft kein Grund, dass er nicht in amerikanischen Arrest kam? Welche Geisteshaltung stand hinter den Predigten in amerikanischer Haft?
Werkstattberichte
Der zweite Tag stand ganz im Zeichen gelebter Praxis der Archivarinnen und Archivare. Insgesamt sieben Werkstattberichte gaben Einblicke in verschiedene Aufarbeitungen, Ansätze und das Leben von Ordensleuten im Nationalsozialismus.
P. Peter Maria Pendl (Mitglied des Karmelitenordens, Theologe und Historiker): Er ging auf die Doktorarbeit von P. Raimund Bruderhofer ein, die das Schicksal der Karmeliten- und Karmelitinnenklöster in Oberösterreich während der NS-Zeit, inklusive Verfolgung, Enteignung, Widerstand und Wiederaufbau beleuchtet; besonders hervorgehoben wurde P. Paulus Wörndl, der 1944 hingerichtet wurde.
P. Oliver Ruggenthaler (Guardian des Wiener Franziskanerklosters): Der Beitrag zeigte die Ambivalenz innerhalb der Franziskaner zur NS-Zeit – von Opfern und Widerstandskämpfern bis zu Mitläufern und Kollaborateuren – mit Fokus auf Österreich und Südtirol.
Nora Pärr (Historikerin und Archivarin der Ursulinen der Römischen Union in Österreich): Die Wiener Ursulinen betrieben während des NS-Regimes eine geheime Schule für „nichtarische“ Kinder in unmittelbarer Nähe zur Gestapo – eine Form stillen Widerstands, die später literarisch und erinnerungskulturell gewürdigt wurde.
Sr. Clara Maria Neubauer (Archivarin der Kongregation der Schwestern der Unbefleckten Empfängnis Marien in Vorau): Der Seligsprechungsprozess für Sr. Maria Krückl, die 1945 von einem Soldaten ermordet wurde, würdigt ihren mutigen Einsatz für Reinheit, Schutzbedürftige und ihren gelebten Glauben. Ihr Andenken lebt in Biografien, Ausstellungen und Gebeten weiter.
Klaus Birngruber (Archivar im Stift Wilhering und Leiter des Diözesanarchivs Linz): P. Sylvester Birngruber OCist war wegen Widerstands und der Mitgliedschaft in der „Großösterreichischen Freiheitsbewegung“ fünf Jahre lang inhaftiert; ein bis vor kurzem völlig unbekanntes Typoskript mit dem Titel „Maertyrer und Bekenner unserer Zeit“ belegt seine kritische und theologisch fundierte Auseinandersetzung mit dem NS-Regime und eröffnet neue Forschungsansätze.
Martin Kolozs (Publizist und Archivar): Drei Projekte (zwei Bücher, eine Veranstaltungsreihe) stellen den NS-Widerstand von Ordensmännern wie P. Jakob Gapp, P. Schwingshackl, P. Steinmayr und P. Helde in den Mittelpunkt – initiiert von Orden zur Pflege ihrer Erinnerungskultur.
Martin Kroiher (Historiker und Initiator des Portals gedenkort.at): Das Gedenkportal www.gedenkort.at erinnert multimedial an Opfer und Widerstandskämpfer von 1938–1945 in Österreich. Es will neue, digitale Wege des Gedenkens eröffnen – besonders, da die Zeitzeug:innen bald nicht mehr selbst sprechen können.
Stadtrundgang und Hl. Messe
Verena Lorber und Andreas Schmoller vom „Franz und Franziska Jägerstätter Institut“ machten mit den Teilnehmer:innen einen Stadtspaziergang, der eigens für die Tagung zusammengestellt wurde. Von der NSDAP Zentrale bis zum Untersuchungsgefängnis, das sich im ehem. Ursulinenkloster auf der Landstraße (Foto) befand. Klosterzellen wurden zu Gefängniszellen umgebaut, Franz Jägerstätter war bei den Ursulinen in Untersuchungshaft, die Klosterküche war auch Gefängnisküche.
Abgeschlossen wurde der Tag mit einer Führung durch den Mariendom und einer Hl. Messe mit Bischof Manfred Scheuer im Mariendom. In seiner Predigt betonte Bischof Scheuer die Wichtigkeit der Ordensarchive und der kirchlichen Archive. Im Bezug auf das Thema der Jahrestagung bezeichnete er die Archive auch als Gedächtnis der Humanität, dass Erinnern heilt und die Archive die Hoffnung der Kirche nähren.
Gabelsberger Stenografie
Am dritten Tag hatten die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, an einem Workshop zur Gabelsberger Stenografie teilzunehmen. Philipp Gahn, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Münster, eröffnete dabei spannende Einblicke in die Kunst der Kurzschrift. Einige sogenannte „Schattenchroniken“ von Ordensleuten wurden in dieser Stenografie verfasst. Für heutige Archivar:innen und Historiker:innen ist es daher von großem Wert, diese Schrift entziffern und verstehen zu können.
Veranstalter
Die Tagung wurde vom Bereich Kultur und Dokumentation der Österreichischen Ordenskonferenz (ARGE der Ordensarchive Österreichs) in Kooperation mit dem Franz und Franziska Jägerstätter Institut (Katholische Privat-Universität Linz) veranstaltet.
7.5.2025/Ordensgemeinschaften Österreich/HE