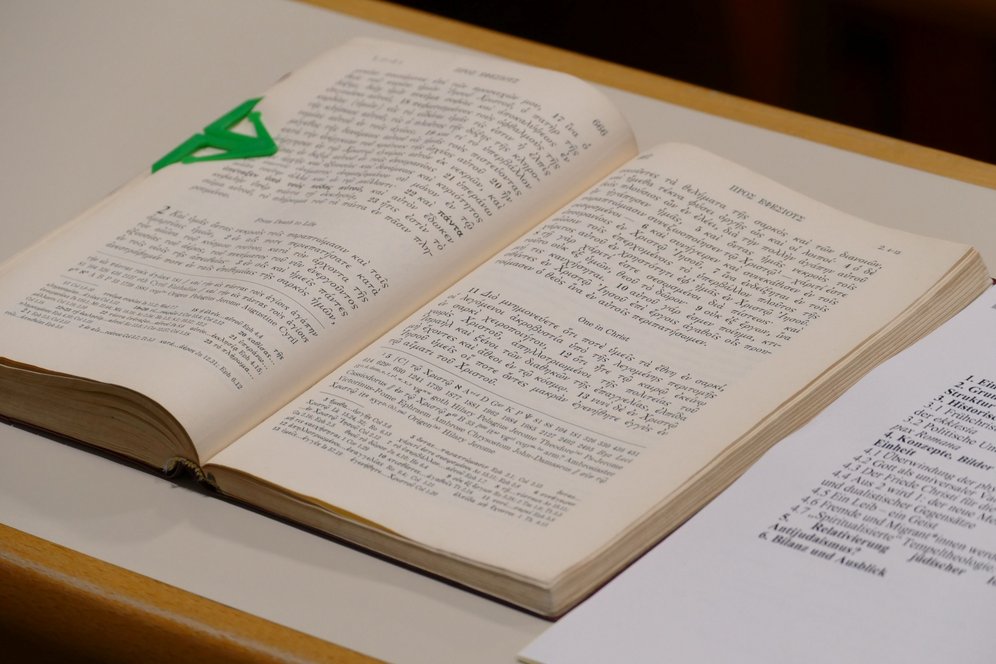Antrittsvorlesung Andrea Taschl-Erber: Ein neuer Friede für die Welt.

In seiner Vorstellung der seit April 2025 als Professorin an der KU Linz wirkenden Andrea Taschl-Erber zeichnete Rektor Michael Fuchs eingangs Ausbildungs- und Karrierestationen einer Lehrenden und Forschenden nach, die schon in den ersten Monaten im Haus Impulse setzte und sich engagiert in der gremialen Arbeit der universitären Selbstverwaltung einbringt. Fragestellungen, Forschungsmethoden und Erträge ihrer wissenschaftlichen Arbeit umriss er anhand der mehrfach ausgezeichneten Dissertation über Maria von Magdala (2006) sowie der Habilitationsschrift über die Rezeption alttestamentlicher Traditionen, Motive und Figuren im Neuen Testament (2017/18). In diesen monumentalen Studien zeigen sich, so Fuchs, Spektren und Schwerpunkte ihres Profils als Wissenschaftlerin.
Kontexte eines neutestamentlichen Briefes
Unter dem Titel Zerbrochene Mauern. Friede und Versöhnung in Eph 2,11–22 bot Andrea Taschl-Erber eine detaillierte und nuancierte Lektüre eines Abschnittes des „Briefs des Paulus an die Epheser“. Dieser wurde nicht von Paulus selbst, sondern in seinem Namen verfasst (und wird daher den sogenannten deuteropaulinischen Briefen zugeordnet). In einer differenzierten Analyse führte Taschl-Erber an Komposition und Struktur des Textes heran, beleuchtete den Wortbestand und die strategisch gewählten Begriffe mit ihren politischen und religiösen Untertönen und machte auf diese Weise verständlich, auf welche spezifische historische Situation der Text antwortet.
Dem jüdischen Verfasser gehe es um die „Entgrenzung“ der zunächst jüdischen Jesusbewegung, er möchte „Fremde“, potenziell also alle Menschen ansprechen und einbinden, und auch nicht ein ausschließendes Christentum konstruieren, das sich gegen das Judentum positioniert. Im Text erfolge ein „Reframing“ jenseits herkömmlicher Identitätskategorien; formuliert werde ein Angebot, das sich bewusst außerhalb überkommener Definitionen von Gemeinschaft und Zugehörigkeit stelle. Der Epheserbrief, unterstrich Taschl-Erber, mache uns zu Zeugen eines Formierungs- und Findungsprozesses, in dem Fragen der (Glaubens-)Identität verhandelt werden: Denn mit der angezielten übergeordneten und einenden Identität – Menschen sollen „einer in Christus“ (vgl. Gal 3,28) sein – werde jede ethnisch oder sozial fundierte Ordnung transzendiert.
Der historische Rahmen dieses Prozesses war die „Pax Romana“, ein von den römischen Imperatoren, die sich als Friedenstifter inszenierten, erzwungener Friede. Im jüdisch-römischen Krieg 70 n. hatte jüdischer Widerstand gegen die römische Kolonialmacht in der Katastrophe geendet. Im Neuen Testament artikuliert sich Widerstand leise und subtil: Im Gegenmodell von Friede und Versöhnung im Epheserbrief ist der wahre Friedensbringer nicht der Kaiser als triumphaler Kriegsherr und Friedenserzwinger – man denke an die Inszenierung z.B. auf Triumphbögen – sondern Jesus Christus. Er sei keine imperiale Figur, die durch militärische Unterwerfung agiert, sein Weg ist ein völlig anderer: Er opfert nicht Leben anderer für einen Frieden durch Angst, sondern er opfert sein Leben und öffnet so die Möglichkeit für umfassende Versöhnung.
„Inklusiver Friede“: Überwindung des ausschließenden Denkens
Die messianische Vision einer versammelten Gemeinschaft „neuer Menschen“ (im universalen Schöpfungshorizont) sei sowohl vertikal (Mensch/Gott) als auch horizontal (Mensch/Mitmensch) getragen von Versöhnung. Schon im Monotheismus selbst liege, wie bereits ersttestamentliche prophetische Visionen zeigen, die Öffnung für alle Menschen. Ein universaler Gott könne nicht exklusiver Gott nur einer Gruppe sein, sondern müsse in dem Sinne inklusiv sein, dass er, jeden Ethnozentrismus und jede In-Group-Abschließung überwindend, ein Gott für alle sein kann. Auf dieser Linie liege die Relativierung aller „Identitätsmarker“ im Epheserbrief, wie sie gerade in paulinischer Tradition die Diskurse der damaligen Zeit – und darüber hinaus – prägten. Beispielhaft machte Taschl-Erber dies am Bild der „Mauer“ und am „Gesetz“ fest. Aufgehoben werde im Epheserbrief nicht deren sachliche bzw. inhaltliche Bestimmung, sondern deren trennende Wirkung: Feindschaft statt Freundschaft zu stiften.
Sosehr eine heilende Versöhnung den Text motiviere, so klar müsse man benennen, was ausgeblendet werde, schloss Taschl-Erber ihren Vortrag. Darüber, dass es alternative Wege zu Gott geben könnte, denke der Verfasser nicht nach: Er wolle zwar einladend und inklusiv sein, es sei aber eine Inklusion ohne Außenseite. Nicht verschwiegen werden dürfe auch, dass bestimmte Aussagen antijüdisch ausgelegt werden können und wurden.
Was aber bis heute und auch in Zukunft gültig bleibe, sei die Vision einer versöhnten Einheit der Gemeinschaft: Der Brief an die Epheser gebe die Frage auf, wie sich diese positive Heterotopie in unsere Welt konkret verorten und leben lasse.
Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Taschl-Erber studierte Katholische Theologie und Klassische Philologie an der Universität Wien und promovierte 2006 mit der Arbeit „Maria von Magdala – erste Apostolin? Joh 20,1–18: Tradition und Relecture“. 2018 erwarb sie an der Universität Graz die venia docendi für Neutestamentliche Bibelwissenschaft und Biblische Theologie mit der Habilitationsschrift „Schriftauslegung im Neuen Testament – Angelpunkt für ‚the Parting of the Ways‘? Fallstudien zur Rezeption alttestamentlicher Traditionen, Motive und Figuren“. Von 2019 bis 2022 war sie Vizerektorin für Religiöse Bildung und Interreligiösen Dialog an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems, anschließend hatte sie die Professur für Exegese und Theologie des Neuen Testaments am Institut für Katholische Theologie an der Universität Paderborn inne.
Seit 1. April 2025 ist sie Inhaberin des Lehrstuhls für neutestamentliche Bibelwissenschaft an der KU Linz. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte reichen von den Deuteropaulinen, der Verortung neutestamentlicher Texte im Horizont des antiken Judentums sowie Frauen- und Geschlechterforschung bis hin zum Interreligiösen Dialog.
15.11.2025/RK/HE