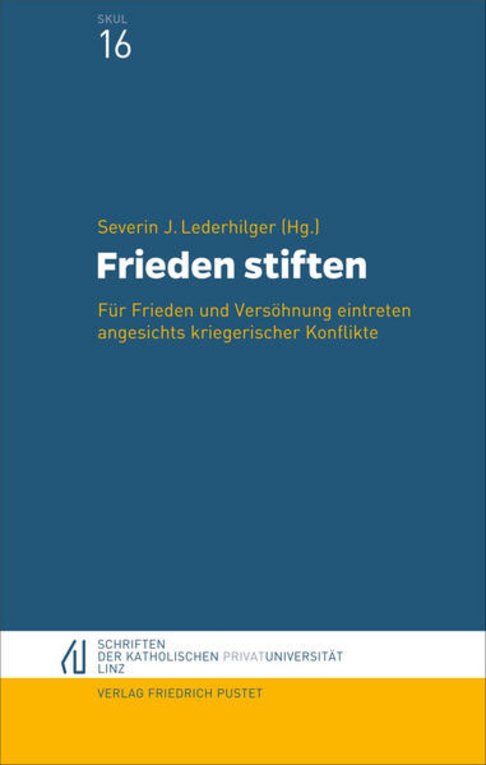Frieden stiften
Beiträge der 25. Ökumenischen Sommerakademie
Stift Kremsmünster, 10. bis 12. Juli 2024
Ob und wie in kriegerischen Konflikten Frieden gestiftet werden kann, ist Thema des vorliegenden Bandes. Die aktuellen Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten haben diese Fragen auch in Europa besonders aktuell werden lassen. Nach einem Überblick über Krieg und Frieden in Geschichte und Gegenwart werden die politischen Aspekte von Konflikten und Kriegen analysiert. Inwieweit christliche Kirchen zu Frieden und Versöhnung beitragen können, wird aus theologischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive untersucht. Ein interdisziplinärer Blick auf Verantwortung, Tragweite und konkrete Friedenswege.
Aus dem Vorwort von Herausgeber Severin J. Lederhilger
Diesem komplexen Fragenkreis stellte sich die 25. Ökumenische Sommerakademie in Kremsmünster vom 10. bis 12. Juli 2024 unter dem Titel "Frieden stiften". Von unterschiedlichen Zugängen und Perspektiven haben die Vortragenden aufgrund ihres jeweiligen wissenschaftlichen, beruflichen, konfessionellen und nationalen Hintergrundes aktuelle politische und weltanschauliche Entwicklungen beschrieben und reflektiert. Der Tagungsband dokumentiert die wissenschaftlichen, kirchenamtlichen, journalistischen und praxisbezogenen Referate, wobei die Manuskripte mitunter bewusst deren ursprüngliche Dialogform beibehalten haben.
Zunächst gibt der ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz (Wien) einen ideen- und militärhistorischen Überblick zu Krieg und Frieden in Geschichte und Gegenwart, wobei er speziell auch die propagandistische Kommunikation als strategisches Mittel verdeutlicht. Dazu analysiert der Historiker Hannes Leidinger (Wien) die politischen Aspekte von Konflikten und Kriegen, betrachtet den Wandel von Moral- und Friedensprinzipien, mögliche Militärkulturen, den Einfluss von Religionsvorstellungen und philosophischen Deutungsmustern sowie die völkerrechtlichen und diplomatischen Lösungsansätze für den meist „langen Weg zum Frieden“. Dies ergänzt der Politikwissenschaftler Oliver Hidalgo (Passau), indem er die "Erklärungsversuche für die politische Ambivalenz von Religionen" zwischen Frieden und Gewalt beleuchtet, da sie in der Lage sind, bereits existierende geo-politische, sozioökonomische, kulturelle und theologische Bruch- und Konfliktlinien zu strukturieren und/oder zu perpetuieren.
Demgegenüber stellt die Sozialwissenschaftlerin Katja Winkler (Linz) die “Friedenspotentiale im Katholizismus" heraus, während die Programmleiterin für Globale Lutherische Theologie Eva Harasta (Genf) aus einer internationalen Perspektive die ökumenische Suche nach Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung darstellt. Konkretisiert wird dies durch die evangelische Pfarrerin Alexandra Battenberg (Schwechat / St. Pölten) anhand der Versöhnungsarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg in der englischen Stadt Coventry, deren zerbombte Kathedrale gleichsam „von der Asche zum Leuchtfeuer“ für den Frieden wurde. Die unterschiedlichen Herausforderungen und Zugänge zur kirchlichen Friedensarbeit gerade in internationalen Krisengebieten zeigen die Plädoyers in der Diskussionsrunde mit dem katholischen Militärbischof Werner Freistätter (Wien), dem armenisch-apostolischen Bischof für Mitteleuropa und Skandinavien Tiran Petrosyan (Wien) sowie dem oberösterreichischen Superintendenten der evangelischen Kirche A. B. Gerold Lehner (Linz). Dabei kommen sowohl pazifistische Zeugnisse als auch die Aufgabe der Militärseelsorge sowie die Rolle der Kirche angesichts der weltweit kaum wahrgenommenen menschlichen und kulturellen Tragödien im Bergkarabach-Konflikt zur Sprache. Dies wird durch die friedensethischen Überlegungen des katholischen Diözesanbischofs Manfred Scheuer (Linz) weitergeführt, der geprägt von den Eindrücken einer Syrien-Reise nach der Möglichkeit fragt, wie man gerade Kindern in zerstörten Ländern wieder Hoffnung schenken kann. Der Tagungsband endet mit Predigtgedanken des Herausgebers zu alltagstauglichen „Kleidern der Liebe“ (Kol 3,12–15) zwischen Provokation und Friedenssehnsucht.
Bericht zur 25. Ökumenischen Sommerakademie.
Über die Ökumenische Sommerakademie
Mit der 25. Sommerakademie endete diese 1999 begründete Veranstaltungsreihe der Katholischen Privat-Universität Linz (KU Linz), des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ), des Evangelischen Bildungswerks Oberösterreich, der Kirchenzeitung der Diözese Linz, des Stiftes Kremsmünster, der Religionsabteilung des ORF und des Landes Oberösterreich.
Die Ökumenische Sommerakademie widmete sich wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen, bei denen Kirchen und Theolog:innen gefordert sind, Stellung zu nehmen und Antworten zu finden. Die Themen waren breit gestreut und reichten von Politik und Ökonomie über Gentechnik, Hirnforschung und digitale Revolution bis zu existentiellen Fragen der einzelnen Menschen bzw. der Gesellschaft.